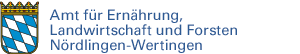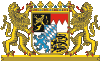Wie in Südfrankreich und Italien
In schwäbischen Ackerbauregionen macht sich Klimawandel bemerkbar
Die nordschwäbischen Ackerbauern werden sich umstellen müssen. Schon heute ist die durchschnittliche Jahrestemperatur in der Ackerbauregion zwischen Wörnitz, Lech und Donau 1,6°C höher als 1991.
Gegenden wie das Nördlinger Ries, in denen die Jahresmittel schon bisher über dem bayerischen Durchschnitt lagen, werden umso mehr gegen die Auswirkungen des Klimawandels zu kämpfen haben. Pflanzenbau-Experte Helmut Stöcker vom AELF Nördlingen-Wertingen erklärt die Auswirkungen der Erderwärmung auf den Ackerbau und wie die Landwirte darauf reagieren können.
Was sich geändert hat und künftig noch mehr ändern wird, macht Stöcker an den langjährigen Messdaten der Wetterstation Frauenriedhausen in der Mitte des Landkreises Dillingen deutlich. In ihnen zeigt sich, dass sich die durchschnittliche Jahrestemperatur seit 1991 um 1,6°C erhöht, die Niederschläge und die Sonneneinstrahlung zugenommen haben. Infolgedessen hat sich die Vegetationszeit um 17 Tage verlängert. "Diese Daten lassen sich freilich nicht eins zu eins auf jedes künftige Jahr übertragen", sagt Stöcker. "Aber sie verdeutlichen eine Tendenz."
Sprunghafter Anstieg des CO2-Gehalts
Zu dieser Tendenz gehört auch das sprunghafte Ansteigen des CO2-Gehalts in der Atmosphäre seit der industriellen Revolution in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Überdies hat sich das globale Temperaturmittel um 1,2°C erhöht. "Damit ist das 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Klimaabkommen fast schon erreicht", stellt Stöcker fest. "Und wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wird die Durchschnittstemperatur im Jahr 2100 um 4,4 bis 6°C höher liegen als heute."
Sechzehn Frosttage weniger
Was auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinen mag: Auf der Nordhalbkugel, zu der auch Schwaben gehört, mache sich die Erderwärmung noch stärker bemerkbar als auf der Südhalbkugel, bestätigt Stöcker. So bewegte sich die Durchschnittstemperatur in Bayern zwischen 1881 und 1900 bei 6,9°C, zwischen 1971 und 2000 bei 7,8°C und zwischen 2011 und 2020 bereits bei 8,6°C. Außerdem wurden in Bayern zwischen 2011 und 2020 jeweils von Februar bis April 30 % weniger Niederschläge verzeichnet als im selben Monatszeitraum der Jahre 1971 bis 2000. Dagegen sank die Niederschlagsmenge zwischen Juni und August nur um 10 %. "In der schwäbischen Donauregion gibt es inzwischen jährlich sechzehn Tage mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt weniger als 1951", sagt Stöcker.
Bodenfeuchtigkeit verdunstet schneller
Die höheren Temperaturen und die vermehrte Sonneneinstrahlung zeigen Wirkung: Es kommt zu einer erhöhten Verdunstung der im Boden gespeicherten Feuchtigkeit, dadurch gelangt mehr Wasserdampf in die Luft, was wiederum zu größeren Wasser-mengen pro Niederschlagsereignis führt. Auf diese Weise erhöht sich die Gefahr von Bodenerosionen und des oberflächigen Wasserabflusses nach längeren Trockenperioden. Anhaltende Hochdrucklagen sorgen für einen Rückgang der sommerlichen Niederschlagsmengen, längere Trockenzeiten erhöhen die Dürregefahr. Zudem sorgt die Wärme für mehr Energie in der Atmosphäre, die sich umso häufiger in extremen Wetterereignissen entladen kann.
Vegetationszeit dehnt sich aus
Die geringere Anzahl von Frosttagen und die häufigeren Hitzetage verfehlen nicht ihre Wirkung auf die bäuerlichen Kulturen: Die Vegetationszeit beginnt immer früher und dauert immer länger, der Entwicklungsverlauf der Pflanzen verschiebt und verkürzt sich. "Deshalb dehnen sich die Anbauregionen zunehmen nach Norden aus", stellt Stöcker fest. Er verschweigt nicht, dass es durchaus Ackerkulturen gibt, die vom Klimawandel mit den gestiegenen Temperaturen und CO2-Gehalten in der Atmosphäre profitieren. So sei beispielsweise bei Getreide und Raps mit höheren Erträgen zu rechnen, weil diese Pflanzen das Kohlendioxid gut verwerten können. "Die Weizenerträge werden in unserer Region steigen." Beim Mais allerdings sei die Grenze der Verwertung bereits erreicht, von der zunehmenden Wärme könne diese Pflanzenart allerdings noch profitieren.
Zweifel an zweiter Ernte
Stöcker dämpft jedoch Erwartungen, dass deshalb in der Region in absehbarer Zeit eine Zweitfrucht angebaut und geerntet werden kann. "Da bin ich skeptisch, weil es infolge der höheren Temperaturen und längeren Trockenperioden Probleme mit der Wasserversorgung der Kulturen geben könnte." Möglich hält er aber den Einsatz späterer Reifegruppen beim Mais. Zu überlegen seien auch frühere Saatzeiten bei Sommerungen – "aber Achtung, das Risiko von Spätfrösten erhöht sich!"
Wärmeliebende Pflanzen als Alternative
Immerhin gibt es auch Alternativen wie den Anbau von wärmeliebenden Pflanzen wie Soja, Körnerhirse, Mais, Sonnenblumen oder Wintergerste. Auch trockentolerante Arten könnten im Klimawandel ihren Vorteil ausspielen, beispielsweise Luzerne, Hirse, Roggen, Triticale, Lupine, Quinoa, Linse oder Kichererbse. Allgemein seien Winterungen im Klimawandel im Vorteil, weil sie die Winterfeuchte nutzen können.
Zwischenfrüchte sorgen für Bodenstabilität
Stöcker führt weitere Maßnahmen auf, mit denen die Landwirte im Ackerbau der Erderwärmung begegnen können: Vielfältige Fruchtfolgen mindern das Anbaurisiko, die pfluglose Bodenbearbeitung schützt den Boden besser vor Erosion, frühreife Arten profitieren von der verlängerten Vegetationszeit, Zwischenfrüchte stabilisieren den Boden, verbessern die Wasseraufnahme und schützen ebenfalls vor Erosion. Bei der Sortenwahl könnten die Landwirte auf Resistenzen gegen wärmeliebende Krankheiten und Schädlinge achten. Winterungen könnten sie später aussäen und dabei die gängigen Saatstärken mit Blick auf den Wasserverbrauch des Blattapparats reduzieren. Stöcker empfiehlt außerdem eine tiefere Saat bei Trockenheit.
Risiko der Stickstoffauswaschung
Bei der Düngung gelte es zu beachten, dass die wärmeren Winter zu einer verstärkten Mineralisation von organischer Substanz führen und größere Niederschlagsmengen die Auswaschung von Stickstoff begünstigen. Bei Trockenheit kann wiederum die Effektivität der Düngung abnehmen. Auch der Pflanzenschutz erfordere eine Anpassungsstrategie, da sich aufgrund des Klimawandels wärmeliebende Beikräuter, Krankheiten und Schädlinge weiter ausbreiten werden. Wachstumsregler könnten Sturmschäden vorbeugen.
Wasseraushalt des Bodens verbessern
Um die Bodenfruchtbarkeit zu fördern, rät Stöcker zur Verbesserung des Wasserhaushalts, zur Vermeidung von Erosion und Verdichtungen sowie zu Maßnahmen, die das Bodenleben begünstigen. Dazu gehörten beispielsweise die Mulchsaat und unter trockenen Bedingungen die flache Bodenbearbeitung. Einen Beitrag im Wettlauf mit dem Klimawandel müsse auch die Pflanzenzüchtung leisten, indem sie ihr Augenmerk auf Trockentoleranz, Stresstoleranz und Abreifeverhalten legt. Zur Absicherung gegen die steigenden Anbau- und Ernterisiken könnten die Landwirte eine Mehrgefahrenversicherung abschließen.
Schwäbisches Italien?
"Wer sich ein Bild von der schwäbischen Landwirtschaft im Jahr 2100 machen will, der muss nur nach Südfrankreich oder Italien reisen", sagt Stöcker. Dort wirtschaften die bäuerlichen Betriebe schon heute unter klimatischen Bedingungen, wie sie eine ungebremste Erderwärmung in absehbarer Zeit auch in unseren heimischen Breiten hervorbringen wird.
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden