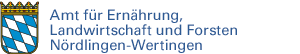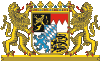Ernte-Pressegespräch des AELF Nördlingen-Wertingen auf der Killischwaige
Von einem in das andere Extrem
Extremer geht es nicht: Im Juni 2024 hatte der Bauernhof der Familie Müller wie eine einsame Insel aus dem verheerenden Donauhochwasser geragt, Anfang Juli 2025 sind die Äcker rund um die Killischwaige von tiefen und breiten Trockenrissen durchzogen. Doch genau so wenig, wie die Bevölkerung im vergangenen Jahr Hunger leiden musste, wird sie auch heuer unter Hunger leiden.
Die globalisierten Märkte sorgen für Ernährungssicherheit auf der einen und für Preise, die den regionalen Verhältnissen oft genug nicht angemessen sind, auf der anderen Seite. Dieses Missverhältnis bestimmte auch die Diskussionen auf dem Ernte-Pressegespräch des AELF Nördlingen-Wertingen auf der Killischwaige bei Tapfheim.
Wie Junior-Betriebsleiter Stefan Müller erklärt, ist nahezu die gesamte Nutzfläche des reinen Ackerbaubetriebs arrondiert. Was arbeitswirtschaftlich ein enormer Vorteil ist, wurde beim Junihochwasser 2024 jedoch schnell zum Nachteil. „Unsere Flächen waren komplett überflutet. Die Hälfte des Weizens und des Körnermaises und 35 Prozent unserer Zuckerrüben waren ein Totalausfall.“ Die Familie Müller hatte daraufhin die von der bayerischen Staatsregierung in Aussicht gestellte Entschädigung beantragt und inzwischen zum Großteil auch erhalten. Anfang Juli bot sich zum Ernte-Pressegespräch ein völlig anderes Bild, nachdem es wochenlang nicht geregnet und extrem hohe Temperaturen geherrscht hatten: Die Schwemmlandböden in Donaunähe sind stellenweise tief aufgerissen und lassen dennoch eine gute Ernte erwarten.
Hoher Grad an Digitalisierung
Die Familie Müller - Vater Hubert und seine Ehefrau Helga, die Söhne Stefan und Max - baut vorwiegend Eliteweizen, Zuckerrüben und Körnermais an. Zwischenfrüchte sorgen für eine kontinuierliche Bedeckung der Böden, sparen Pflanzenschutzmittel und Dünger ein. „Wir wirtschaften ausschließlich pfluglos und wenden die Mulchsaat an“, sagt Stefan Müller. Eine zusätzliche Einnahmequelle bilden die Hackschnitzel aus dem eigenen Wald. Weit fortgeschritten ist auf der Killischwaige die Digitalisierung. Zwei Schlepper sind mit einem RTK-Lenksystem ausgestattet, seit März 2025 ist ein Stickstoffsensor zur zielgenauen Düngung im Einsatz.
Hitze hat Früchten „extrem wehgetan“
Die extremen Witterungsverhältnisse machte auch der Leiter des AELF Nördlingen-Wertingen zum Thema des Pressegesprächs. Der Juni 2025 sei der heißeste Monat gewesen, der jemals in Mitteleuropa gemessen wurde, sagt Dr. Reinhard Bader. Die Hitze habe den Feldfrüchten „extrem wehgetan“, insgesamt seien aber die Niederschläge gerade noch ausreichend gewesen. Die Ernährungssicherheit zu gewährleisten sei übrigens die wichtigste Aufgabe der Landwirtschaft, so Bader. Dabei müsse sich diese fragen, wie sie sich mit Blick auf den Klimawandel aufstellen soll. Dass die Bauern hier schon weiterdenken, zeige ihre Experimentierfreudigkeit, mit der sie den Anbau von alternativen, klimatoleranten Kulturen ausprobieren.
Schilf-Glasflügelzikade breitet sich aus
Eine weitere Herausforderung sind Schadinsekten, die von der zunehmenden Erderwärmung profitieren. Dazu gehört beispielsweise die Schilf-Glasflügelzikade, durch die bakterielle Pflanzenkrankheiten wie Stolbur und Syndrome Basses Richesses (SBR) auf Zuckerrüben, Kartoffeln und Gemüsekulturen übertragen werden. „Die Zikade ist die größte Bedrohung für die Ernährungssicherheit seit Jahrzehnten“, stellt Erhard Würth fest. Wie der Leiter der Abteilung Bildung und Beratung am AELF Nördlingen-Wertingen erklärt, lassen sich die bakteriellen Erreger nicht direkt bekämpfen, was zu erheblichen Qualitäts- und Ertragsverlusten führen kann. Abhilfe könnte eher noch eine sorgsam gewählte Fruchtfolge mit dem Anbau von späten Sommerungen nach Zuckerrüben und Kartoffeln schaffen, um die Vermehrung der Zikaden zu unterbrechen. Dazu müssten freilich alle Anbauer von Wirtspflanzen gemeinsam vorgehen. Um das Auftreten der Schilf-Glasflügelzikaden möglichst effizient zu reduzieren, hat das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit Notfallzulassungen für ansonsten nicht erlaubte Pflanzenschutzmittel gewährt.
Tiefreichendes Wurzelwerk gebildet
Würths Amtskollege Helmut Stöcker erwähnt die ergiebigen Niederschläge ab Mitte September, die bei der Ernte der später abreifenden Kulturen zu unerwünschten Bodenverdichtungen führten. Diese ließen für das auf solchen Flächen folgende Wintergetreide keine guten Wachstumsbedingungen erwarten. Ohnehin verzögerte sich aufgrund der hohen Bodenfeuchte die Aussaat von Wintergerste, Wintertriticale, Winterweizen und Dinkel. Immerhin froren die Zwischenfrüchte Mitte Januar und Mitte Februar zuverlässig ab. Anschließend folgte eine lange Trockenphase bis zum 22. April. Sie bot ausreichend Gelegenheit zur Ausbringung organischer Dünger und zur zeitgerechten Aussaat von Frühjahrskulturen. In der Trockenphase hatten die Getreide- und Rapsbestände ein tiefreichendes Wurzelwerk gebildet, so dass mit den Niederschlägen im Mai die Hoffnung auf zufriedenstellende Erträge stieg. Halbwegs befriedigend war laut Stöcker der erste Grünlandschnitt, der zweite Aufwuchs stellte die Landwirte dann meist gänzlich zufrieden.
Schnelle Abreife
Aufgrund des trockenen Frühjahrs blieb der Krankheitsdruck im Getreide gering, so dass die Maßnahmen zur Pilzbekämpfung reduziert werden konnten. Bei der Wintergerste sorgte der Regen Anfang Juni noch für ein gutes Tausendkorngewicht, beim Winterweizen kam es jedoch vermehrt zu Fusarieninfektionen. Ab Anfang Juni traten zunehmend Schilf-Glasflügelzikaden auf. Die Trockenheit und die heißen Tage ab Mitte Juni ließen die Getreide- und Winterrapsbestände schnell abreifen, so dass hier höchstens mäßige bis durchschnittliche Erträge zu erwarten sind.
Verschiebungen im Anbau
Interessant sind im Landkreis Donau-Ries die Verschiebungen im Anbau, die Stöcker auflistet. So hat sich die Winterdinkelfläche von 3114 ha im Jahr 2020 auf 1995 ha im vergangenen Jahr reduziert, die Winterweizenfläche von 16328 ha im Jahr 2005 auf nurmehr 13216 ha. Die Wintergerste ging im selben Zeitraum von 9412 auf 5618 ha zurück. Im Trend liegen dagegen Wintertriticale, Silomais, Zuckerrüben, Sojabohnen, Spargel und Feldfutter. Während der Grünlandanteil nahezu stabil ist, reduzierte sich die Rapsfläche von 3771 ha im Jahr 2005 auf 1577 ha im vergangenen Jahr.
Bürokratie dämpft Investitionsbereitschaft
Der Kreisobmann des Bauernverbands, Karlheinz Götz, setzt darauf, dass Erzeuger, Behörden und Forschung bei der Bekämpfung der Schilf-Glasflügelzikade zusammenarbeiten, wenn auch die globalisierten Märkte die Bedeutung der regionalen Erträge verringert. Das Risiko lasse sich aber über Verträge minimieren. Während es im Milch- und Fleischbereich derzeit gute Preise für die Erzeuger gebe, sei der Preis für Schweinefleisch wieder einmal rückläufig. Einem Teil der Bauern werde die Lust am Investieren von der ausufernden Bürokratie vergällt, klagt Götz. Dazu geselle sich der Ärger über die steigenden Mindestlöhne für Saisonarbeiter. Gehe es so weiter, werde ein Teil der Produktion und Wertschöpfung in andere Länder abwandern.
Dinkelanbau massiv ausgedehnt
Michael Sailer, Geschäftsführer der SLP – Schwäbische Landprodukte, erwartet heuer für Nordschwaben „eher gute“ Erträge beim Dinkel. Obwohl der Anbau in Bayern aufgrund des Nachfragebooms und der guten Preise um 50% ausgedehnt wurde, sei mit 25 bis 30 €/dt zu rechnen. Bei der Wintergerste rechnet Sailer mit 16 bis 17 €, beim B-Weizen mit 18,50 € pro Dezitonne und entsprechend ein paar Euro mehr beim A-Weizen. Auch Franz Gerstmeier, Vorsitzender der Getreide-EG Donauwörth, setzt auf befriedigende Erträge, beklagt jedoch, dass es immer schwieriger werde, Vorverträge abzuschließen. Der Donau-Rieser vlf-Vorsitzende Jürgen Wörner ärgert sich, dass der Handel die Wintergerste „verramscht“.
Raps wettbewerbsfähiger als Sojabohne
Dem widerspricht Frank Ruf, Geschäftsführer der AGRO Donau-Ries. Die Wintergerste werde keineswegs verramscht, sondern marktgerecht verkauft. Aufgrund der Börsen und der globalisierten Märkte werde die Vermarktung aber zunehmend schwierig. Seit Monaten bewege sich der Rapspreis stabil auf einem Niveau von 45 bis 48 €/dt. Der Anbau von Soja sei wiederum nur wirtschaftlich, wenn die Bohnen nicht getrocknet werden müssen, erklärt Ruf. Aktuell sei die Sojabohne sowohl mit Blick auf den Ertrag als auch auf den Preis deutlich weniger wettbewerbsfähig als Raps. Dessen Anbausicherheit sei auch ungleich höher.
Niedrige Dollar-Notierung drückt auf Weizenpreis
„Volatile Börsen sind auch Chancen“, betont Robert Fenis, Leiter des Brotgetreidehandels bei der BayWa. Allerdings müssten die bäuerlichen Betriebe diese Chancen auch nutzen. Fenis räumt ein, dass sich die Weizenbörsen seit Februar negativ entwickeln. Allein durch den sinkenden Wert des Dollar sei ein Preisrückgang um 15 % zu verzeichnen. Der Getreidehändler erwartet für heuer eine gute Wintergersten-Ernte und mindestens durchschnittliche Weizenerträge.
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden